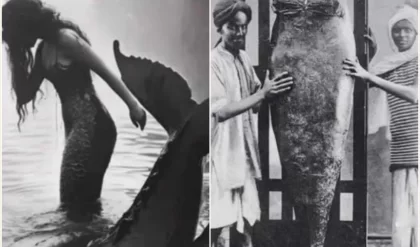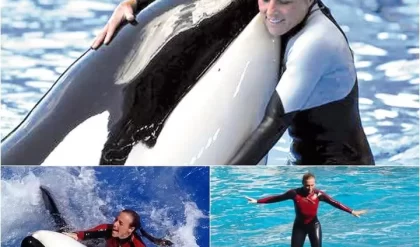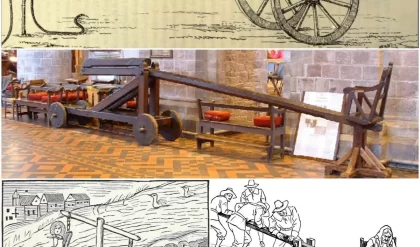In einem erschreckenden archäologischen Durchbruch haben Forscher den möglicherweise erst zweiten bestätigten Fall einer Kreuzigung in der Geschichte entdeckt und damit neues Licht auf eine der grausamsten Hinrichtungsmethoden der Antike geworfen. Die 2007 in der Nähe von Gavello, südwestlich von Venedig in Norditalien, entdeckten 2.000 Jahre alten Skelettreste enthüllen eine verstörende Geschichte der Gewalt und Ausgrenzung in der römischen Gesellschaft. Dieser Fund, veröffentlicht in der Aprilausgabe 2018 von Archaeological and Anthropological Sciences unter dem Titel „Eine multidisziplinäre Studie zum Fersenbeintrauma im römischen Italien: Ein möglicher Fall einer Kreuzigung?“, hat die Faszination für eine ebenso weit verbreitete wie brutale Praxis neu entfacht.
Ein Skelett, das eine Geschichte von Folter erzählt
Was diesen Fund so außergewöhnlich macht, sind die deutlichen Spuren einer Kreuzigung, die in die Knochen eingraviert sind. Die Überreste eines Mannes, der ohne Grab oder Grabbeigaben direkt in der Erde begraben wurde, fielen sofort als ungewöhnlich auf. Co-Autorin Emanuela Gualdi von der Universität Ferrara erklärte gegenüber der italienischen Zeitung Estenencia , die unzeremonielle Bestattung des Leichnams lasse darauf schließen, dass es sich bei dem Mann wahrscheinlich um einen Gefangenen oder jemanden handelte, der in der römischen Gesellschaft als gefährlich oder verachtet galt. Diese Marginalisierung deutete auf ein düsteres Schicksal hin, doch erst die detaillierte Untersuchung des Skeletts enthüllte den wahren Schrecken.

Ein einzelnes, strategisch platziertes Loch im Fersenbein, dem sogenannten Calcaneus, lieferte den entscheidenden Hinweis. Im Gegensatz zu anderen natürlichen Knochenspuren wie Wurzelätzungen oder Tierbefall war diese Perforation deutlich erkennbar. Dies deutet darauf hin, dass sie von einem Nagel stammte, der durch den Fuß getrieben wurde, um das Opfer an einem Holzkreuz zu befestigen. Gualdi bemerkte: „Trotz des schlechten Erhaltungszustands konnten wir am Skelett Spuren nachweisen, die auf kreuzigungsähnliche Gewalt hindeuten.“ An den Handgelenken wurden jedoch keine Hinweise auf Nagelungen gefunden, was die Forscher zu der Vermutung veranlasste, dass die Arme möglicherweise an das Kreuz gebunden waren, eine Praxis, die auch in einem anderen seltenen Fall aus Jerusalem vermutet wird.
Der Jerusalemer Präzedenzfall: ein Nagel durch die Ferse
Dieser italienische Fund ist erst der zweite dokumentierte Fall einer Kreuzigung. Die erste wurde 1968 vom Archäologen Dr. Vassilios Tzaferis in Jerusalem entdeckt. Bei Ausgrabungen auf einem jüdischen Friedhof aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. bis 70 n. Chr. entdeckte Tzaferis einen 11,5 cm langen, von einem Fingernagel durchbohrten Fersenknochen, an dem noch Olivenholzfragmente hafteten – ein erschreckender Beweis für die Kreuzigung. In einem 1985 in der Zeitschrift Review of Biblical Archaeology erschienenen Artikel widerlegte Tzaferis den Mythos, die Kreuzigung sei eine römische Erfindung, und wies darauf hin, dass die Assyrer, Phönizier und Perser sie bereits im 1. Jahrtausend v. Chr. praktizierten. Die Römer jedoch perfektionierten sie als Terrorinstrument, übernahmen sie von den Karthagern und setzten sie bis weit ins 4. Jahrhundert n. Chr. ein.

Der Jerusalemer Fall gilt aufgrund des erhaltenen Nagels und Holzes weiterhin als Maßstab für Kreuzigungsbeweise. Im Gegensatz dazu fehlt beim Gavello-Fund ein Nagel, was ihn zwar weniger schlüssig, aber nicht weniger überzeugend macht. Co-Autorin Ursula Thun Hohenstein sagte : „Die Bedeutung des Fundes liegt darin, dass es sich um den zweiten dokumentierten Fall weltweit handelt.“ Der marginale Charakter der Bestattung – das Sammeln eines Grabes oder von Opfergaben – stützt die Theorie, dass dieser Mann ein Opfer einer Kreuzigung war, wahrscheinlich ein Sklave, Ausländer oder von der Gesellschaft verstoßener Rebell.
Eine brutale Praxis, von der nur wenige Überreste übrig geblieben sind
Die Kreuzigung war in der Antike eine weit verbreitete und grausame Hinrichtungsmethode, die den untersten Schichten der Gesellschaft vorbehalten war: Sklaven, Rebellen und Fremden. Historische Berichte zeichnen ein düsteres Bild: Alexander der Große ließ 2.000 Überlebende der Eroberung von Tyrus kreuzigen, Marcus Licinius Crassus säumte nach dem Dritten Sklavenkrieg 71 v. Chr. mit 6.000 gekreuzigten Gladiatoren und Sklaven die Via Appia, und Tausende weitere erlitten unter römischer Herrschaft ein ähnliches Schicksal. Der neutestamentliche Bericht über die Kreuzigung Jesu Christi ist nach wie vor der bekannteste, doch unzählige andere erlitten diesen qualvollen Tod.

Warum sind physische Beweise so selten? Die Antwort liegt in der Natur des Brauchs und seinen Folgen. Holzkreuze, Seile und andere organische Materialien, die bei Kreuzigungen verwendet wurden, zersetzten sich mit der Zeit. Eisennägel, ein wertvolles Gut, wurden oft nach dem Tod des Opfers geborgen, manchmal indem man den umliegenden Knochen zerbrach, um sie herauszuziehen, wodurch wichtige Beweise vernichtet wurden. Zudem wurden die Körper Gekreuzigter selten ordnungsgemäß bestattet, sondern verrotteten oft oder wurden in anonymen Gräbern entsorgt, wodurch Skelettreste selten waren.
Ein dritter Fall? Das Geheimnis der Abba-Höhle

Interessanterweise gibt es einen dritten möglichen Fall einer Kreuzigung, der jedoch weiterhin Gegenstand von Debatten ist. 1970 wurden bei Ausgrabungen in der ABBA-Höhle die Knochen eines 25-jährigen Mannes freigelegt, darunter Handknochen mit eingewachsenen Fingernägeln. Obwohl dieser Fund vielversprechend erscheint, wird die Frage, ob die Nägel die Knochen durchdrungen haben, auch Jahrzehnte später noch untersucht. Wie Popular Archaeology anmerkt, unterstreicht die Unsicherheit rund um die ABBA-Höhle die Herausforderung, eine Kreuzigung ohne eindeutige Beweise wie den Jerusalemer Fingernagel nachzuweisen.
Warum das wichtig ist
Der Fund von Gavello ist zwar weniger schlüssig als der von Jerusalem, bietet aber einen seltenen Einblick in ein brutales Kapitel der Menschheitsgeschichte. Er unterstreicht die Grausamkeit der Kreuzigung und die soziale Ausgrenzung ihrer Opfer. Das einzelne Loch im Fersenbein, zusammen mit der marginalisierten Bestattung, zeichnet ein lebendiges Bild eines Mannes, der nicht nur körperliche Qualen, sondern auch soziale Ablehnung erlitt. Während die Forscher diesen Fund weiter untersuchen, stellt er uns vor die Herausforderung, uns mit der Grausamkeit dieser antiken Bestrafung und der Flüchtigkeit ihrer physischen Spuren auseinanderzusetzen.
Könnten noch weitere gekreuzigte Überreste gefunden werden? Angesichts der Tausenden, die dieses Schicksal erlitten, ist es wahrscheinlich. Doch mit wiederverwerteten Fingernägeln, gebrochenen Knochen und weggeworfenen Leichen bleiben Beweise schwer fassbar. Jeder Fund ist daher ein wertvoller Hinweis auf eine ebenso brutale wie verstörende Vergangenheit.