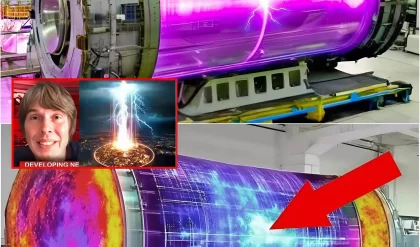In einem der kühnsten Ingenieursprojekte des 21. Jahrhunderts startet China eine kolossale, unfassbare Initiative, die eher nach Science-Fiction als nach Realität klingt. Das 500 Milliarden Dollar teure Megaprojekt „Desert-to-Ocean Initiative“ zielt darauf ab, weite Teile karger, unwirtlicher Wüste in wasserreiche, fruchtbare Landschaften zu verwandeln – und die Welt beobachtet dies mit gleichermaßen Erstaunen und Unbehagen.
Die Vision: Von Sanddünen zu Binnenmeeren
Chinas trockene Nordwestregion mit der Taklamakan- und der Gobi-Wüste gilt seit langem als eine der rauesten und unwirtlichsten Gegenden der Erde. Die über 500.000 Quadratkilometer großen Wüsten tragen zu häufigen Staubstürmen, Umweltschäden und der Vertreibung ländlicher Gemeinden bei. Doch wo andere Ödland sehen, sehen Chinas führende Ingenieure und Umweltplaner Chancen.
Im Mittelpunkt des Projekts steht eine großartige Vision: riesige Wassermengen aus nahegelegenen Flüssen, Grundwasserleitern und sogar Entsalzungsanlagen entlang der Ostküste künstlich in diese kargen Wüsten umzuleiten und so künstliche Seen, Flüsse und fruchtbare Becken zu schaffen, wo einst nur trockene Dünen waren.
Ingenieurskunst in unvorstellbarem Ausmaß
Das Ausmaß dieses Vorhabens ist atemberaubend. Über 1.000 Kilometer Wasserleitungen , 300 Pumpstationen und hochmoderne Entsalzungsanlagen werden gebaut, um Wasser zu transportieren und zu reinigen. Satellitengesteuerte Aushubgeräte und KI-gesteuerte Bewässerungssysteme werden eingesetzt, um die Topografie umzugestalten und den Feuchtigkeitsgehalt in neu entstandenen Feuchtgebieten und landwirtschaftlichen Zonen aufrechtzuerhalten.
Die Nationale Wasserressourcenkommission Chinas, die das Projekt beaufsichtigt, bestätigte, dass die Arbeiten in der Frühphase in Xinjiang und der Inneren Mongolei bereits im Gange seien und dass über 50 Quadratkilometer Wüstenland erfolgreich in grünes, bepflanzbares Gelände umgewandelt worden seien .
„Diese Idee galt einst als unmöglich“, sagte Li Wei , einer der leitenden Ingenieure des Projekts. „Aber mit der heutigen Technologie und unserer Entschlossenheit verwandeln wir uralte Sandmeere in neue Oasen.“
Warum macht China das?
Die Motive hinter diesem kühnen Unterfangen sind sowohl ökologischer als auch geopolitischer Natur.
Einerseits stellt die Wüstenbildung eine zunehmende Bedrohung für Chinas landwirtschaftliche Stabilität und städtische Entwicklung dar. Das Land verliert jährlich rund 2.460 Quadratkilometer Ackerland durch Wüstenbildung . Die Umwandlung von Wüsten in wasserreiche Zonen würde dazu beitragen, die Nahrungsmittelproduktion zu sichern, bewohnbare Gebiete zu erweitern und die verheerenden Staubstürme zu bekämpfen, die Städte wie Peking oft ersticken.
Geopolitische Analysten hingegen deuten darauf hin, dass das Projekt ein wichtiger Schritt in Chinas langfristiger Strategie zur Stärkung seines regionalen Einflusses ist. Indem China seine Fähigkeit zur Eroberung der Natur in diesem Ausmaß demonstriert, sendet es ein klares Zeichen seiner technologischen Stärke und infrastrukturellen Dominanz – eine Botschaft, die Nachbarstaaten und rivalisierende Mächte nicht ignorieren können.
Globale Reaktionen: Ehrfurcht und Alarm
Wenig überraschend fielen die Reaktionen der internationalen Gemeinschaft gemischt aus. Umweltverbände begrüßen die Idee einer Umkehr der Wüstenbildung zwar verhalten, äußern aber Bedenken hinsichtlich der ökologischen Risiken groß angelegter Wasserumleitungsprojekte. Frühere Großprojekte wie der Drei-Schluchten-Damm in China haben sowohl den immensen Nutzen als auch die unvorhergesehenen Umweltfolgen solcher Vorhaben gezeigt.
Geopolitische Kommentatoren warnen unterdessen vor möglichen Streitigkeiten um Wasserrechte, insbesondere mit Ländern unterhalb der großen Flüsse, die für die Desert-to-Ocean-Initiative erschlossen werden. Auch Fragen zur langfristigen Nachhaltigkeit und Umweltethik künstlicher Ökosysteme sorgen für Stirnrunzeln.
Könnte dies das Klima des Planeten verändern?
Einige Wissenschaftler glauben, dass eine solch massive Umgestaltung der Land- und Wassersysteme Auswirkungen auf das regionale – wenn nicht gar globale – Klima haben könnte. Die Einführung großer Wassermassen in bisher trockenen Zonen könnte atmosphärische Muster, Niederschlagsverteilungen und sogar globale Wetterzyklen verändern. Ob diese Veränderungen vorteilhaft oder verheerend wären, bleibt abzuwarten.
Wie geht es weiter?
China plant, die erste große Phase des Projekts bis 2030 abzuschließen und dabei über 5.000 Quadratkilometer Wüste umzuwandeln . Bis 2050 will die Regierung über 20.000 Quadratkilometer umgewandelt und völlig neue Städte, landwirtschaftliche Zentren und Ökosysteme geschaffen haben.
Wenn die Desert-to-Ocean-Initiative erfolgreich ist, wird sie als eine der ehrgeizigsten Umwelttransformationen der Menschheitsgeschichte gelten – eine moderne Große Mauer gegen die brutalsten Kräfte der Natur.
Ob dieses mutige Unterfangen als Blaupause für andere von Dürre betroffene Länder dienen wird oder als warnendes Beispiel für ökologische Übertreibungen, ist eine Geschichte, die die Welt mit Spannung erwartet.